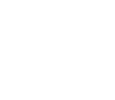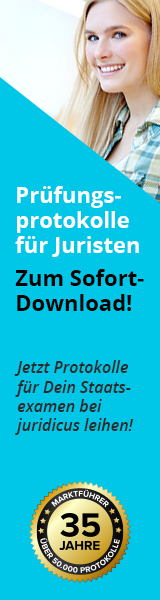Prüfungsthemen: Strafrecht
Vorpunkte der Kandidaten
|
Kandidat |
1 |
|
Endpunkte |
9,02 |
|
Endnote |
10,21 |
|
Endnote 1. Examen |
7,22 |
Zur Sache:
Prüfungsstoff: protokollfest
Prüfungsthemen: StGB AT: Versuch und Rücktritt StGB BT: Körperverletzungsdelikte, inbs. Mord und Totschlag StPO: Entscheidung in der Revision GVG: Instanzenzug im Strafprozessrecht
Paragraphen: §211 StPO, §212 StGB, §23 StGB, §74 GVG, §354 StPO
Prüfungsgespräch: Frage-Antwort-Diskussion, hält Reihenfolge ein, Intensivbefragung Einzelner, verfolgt Zwischenthemen, Fragestellung klar
Prüfungsgespräch:
Der Prüfer schilderte einen Sachverhalt, den er wohl bereits mehrfach geprüft hatte: Drei Personen – B, C und D – stehen neben einem geparkten Pkw und unterhalten sich. D befindet sich auf Höhe des Kofferraums, C in der Mitte des Wagens und B im Bereich der Motorhaube. A fährt an dem Auto vorbei und feuert aus dem geöffneten Seitenfenster in Richtung der Wagenmitte und der Motorhaube. B wird nicht getroffen, springt über die Motorhaube und flüchtet in ein nahegelegenes Gebäude. Auch C und D werden verfehlt und werfen sich zu Boden. Nachdem A erkennt, dass keiner der Anwesenden verletzt wurde, fährt er – obwohl er noch ausreichend Munition besitzt – davon. Der erste Prüfling begann mit dem schwersten Delikt, dem versuchten Totschlag (§§ 212, 23 I, 12 I StGB). Da keine Person zu Tode gekommen war, verneinte er eine vollendete Tat und bejahte die Vorprüfung für den Versuch. Er prüfte den Versuch gegenüber B und C, schloss jedoch D aus, da A offensichtlich nicht in dessen Richtung gezielt hatte. Der Prüfer legte in der Diskussion besonderen Wert auf die präzise Begrifflichkeit: Statt des Ausdrucks „Tatplan“ erwartete er die korrekte Bezeichnung „Tatentschluss“. Der folgende Prüfling ging einen Schritt weiter und prüfte einen versuchten Mord (§§ 211, 23 I, 12 I StGB). Er definierte die Mordmerkmale „Heimtücke“ und „niedrige Beweggründe“ und nahm anschließend eine Subsumtion vor. Der Prüfer merkte an, dass auch das Merkmal der „Mordlust“ zu prüfen gewesen wäre, das jedoch unberücksichtigt blieb. Die Heimtücke wurde letztlich bejaht. Ein weiterer Prüfling befasste sich sodann mit der Frage des Rücktritts. Er unterschied dabei zutreffend zwischen dem Versuch zum Nachteil von C und demjenigen gegenüber B, was dem Prüfer positiv auffiel. Der Prüfling wandte sich der Prüfung bezüglich C zu: Hinsichtlich C verneinte er einen fehlgeschlagenen Versuch, da A noch Munition gehabt habe und somit weitere Schüsse möglich gewesen wären. Der Versuch sei unbeendet gewesen; A habe freiwillig von der weiteren Tatausführung Abstand genommen, indem er wegfuhr – aus autonomen, nicht äußeren Gründen. Beim Rücktritt in Bezug auf B stellte der nächste Prüfling zunächst fest, dass A die Tat gegen B nicht mehr hätte fortsetzen können, da B bereits geflüchtet war. Der Versuch sei daher fehlgeschlagen. Auf die Frage, ob Tateinheit oder Tatmehrheit vorliege, argumentierte der Prüfling für Tatmehrheit. Der Prüfer wandte sich daraufhin wieder an den ersten Prüfling und fragte nach dessen Bewertung. Dieser nahm Tateinheit an, wies jedoch darauf hin, dass umstritten sei, ob innerhalb einer tateinheitlichen Handlung ein teilweiser Rücktritt möglich sei. Diese differenzierte Betrachtung gefiel Herrn Calame. Der Prüfling folgerte, dass ein Rücktritt entweder vollständig oder gar nicht möglich sei, weshalb er den Angeklagten freisprechen würde. Der nächste Prüfling vertrat die Gegenauffassung: Ein teilweiser Rücktritt müsse auch bei Tateinheit zulässig sein. Folglich würde er A wegen versuchten Mordes zum Nachteil des C verurteilen. Auf die Nachfrage, an welcher Stelle er den Rücktritt gegenüber B thematisieren würde, verwies er auf den Vermerk (gemeint waren wohl die Urteilsgründe). Der Prüfer erklärte, dass genau dieser Meinungsstreit in der Praxis relevant gewesen sei: Das Landgericht hatte einen vollständigen Rücktritt bei Tateinheit angenommen und A freigesprochen, während das Revisionsgericht dies anders sah und das Urteil aufhob. Im Anschluss wechselte der Prüfer in den strafprozessualen Teil der Prüfung. Er fragte, welches Gericht für das Verfahren zuständig sei. Der Prüfling nannte zutreffend die Große Strafkammer des Landgerichts (§ 74 I, II GVG), also das sogenannte Schwurgericht. Auf die Frage nach der Revisionsinstanz wurde der Bundesgerichtshof (§ 135 GVG) genannt. Da der Prüfling zunächst irrtümlich das Bayerische Oberste Landesgericht erwähnte, fragte der Prüfer nach dessen Zuständigkeit. Der Prüfling korrigierte sich: Das BayObLG entscheidet über Revisionen gegen Urteile der Berufungsinstanzen (Landgerichte) sowie Sprungrevisionen gegen erstinstanzliche Urteile der Amtsgerichte. Anschließend ging es um die Entscheidungsbefugnisse des BGH. Dieser kann nach § 354 StPO entweder selbst entscheiden oder die Sache zurückverweisen. Eine Entscheidung „in eigener Sache“ nach § 354 I StPO kommt nur bei Delikten mit zwingender lebenslanger Strafe – also Mord – in Betracht, was hier wegen des lediglich versuchten Mordes ausgeschlossen war. Es wurde diskutiert, ob die Aufhebung der Entscheidung mit oder ohne Aufhebung der Feststellungen zu erfolgen habe. Der Prüfling argumentierte, dass das Urteil unter Aufhebung der bisherigen Feststellungen zurückzuverweisen sei, da das erstinstanzliche Gericht den Angeklagten freigesprochen und daher keine Feststellungen zu Milderungsgründen (§ 23 II i.V.m. § 49 I StGB) getroffen habe. Abschließend fragte Herr Calame, an welches Gericht zurückverwiesen wird – an das erstinstanzliche Landgericht, allerdings an eine andere Strafkammer. Damit endete die Prüfung. Hinweis zur Vorbereitung: Fokussiert euch im materiellen Recht auf den Allgemeinen Teil des StGB, insbesondere Versuch und Rücktritt, sowie auf Körperverletzungsdelikte. In der StPO sind der Instanzenzug und die Wirkungen der Revision prüfungsrelevant. Der Prüfer führt die Prüfung strukturiert und freundlich, gibt bei fehlenden Punkten Hinweise und legt Wert auf präzise Definitionen und saubere Subsumtionen. Bleibt ruhig – ihr schafft das! Viel Erfolg und Glück für eure Prüfung.
Bei den obigen anonymisierten Protokollen handelt es sich um eine Original-Mitschrift aus dem zweiten Staatsexamen der Mündlichen Prüfung in Bayern vom Oktober 2025. Das Protokoll stammt aus dem Fundus des Protokollverleihs Juridicus.de.
Weggelassen wurden die Angaben zum Prüferverhalten. Die Schilderung des Falles und die Lösung beruhen ausschließlich auf der Wahrnehmung des Prüflings.