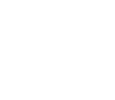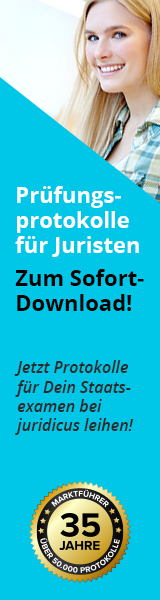Prüfungsthemen: Zivilrecht
Vorpunkte der Kandidaten
|
Kandidat |
1 |
|
Endpunkte |
8,0 |
|
Endnote |
8,0 |
|
Endnote 1. Examen |
7,5 |
Prüfungsgespräch:
Der Prüfer begann die Einheit, indem er uns einen Fall zur gemeinsamen Besprechung vorlegte. Im Mittelpunkt stand ein zivilrechtlicher Streit: Ein Obstlieferant verlangte von einem Safthersteller die Zahlung von 10.000 €, da er behauptete, es sei ein Kaufvertrag über 10 Tonnen Apfelsinen zu diesem Preis geschlossen worden. Der Beklagte – der Safthersteller – bestritt jedoch, dass ein Vertrag zustande gekommen sei. Das Gericht entschied, Beweis durch Zeugenvernehmung eines Mitarbeiters des Klägers zu erheben, um sowohl den Vertragsabschluss als auch die Lieferung der Ware aufzuklären. Auf Basis dieser Zeugenaussage gelangte das Gericht zur Überzeugung, dass sowohl der Vertragsschluss als auch die Lieferung erfolgt waren. Im weiteren Verlauf erklärte der Beklagte die Aufrechnung mit insgesamt drei Gegenforderungen im Gesamtwert von 20.000 €. Auf Nachfrage des Gerichts gab er an, diese Forderungen in der Reihenfolge ihrer Ranghöhe geltend machen zu wollen. Zwar waren die einzelnen Gegenforderungen aufgeführt, wir sind auf diese jedoch inhaltlich kaum eingegangen, sondern haben die Aufrechnung nur in abstrakter Form am Ende kurz thematisiert. Die Fallbesprechung begann mit der Prüfung der sachlichen Zuständigkeit des angerufenen Gerichts, die rasch abgehandelt wurde. Im Anschluss fragte der Prüfer gezielt nach weiteren Zuständigkeitsaspekten. Da keine Angaben zur örtlichen Zuständigkeit vorlagen, wurde über die mögliche Zuständigkeit der Kammer für Handelssachen diskutiert. Diese Möglichkeit hatte der Prüfer offenbar zunächst nicht im Blick, griff sie jedoch auf und stellte vertiefte Fragen zur handelsrechtlichen Einordnung: Handelte es sich um ein beiderseitiges Handelsgeschäft? Welche Normen regeln die Zuständigkeit der Handelskammer? In diesem Kontext fragte er außerdem, warum zu diesem Zeitpunkt keine Verweisung mehr möglich sei, bis wann eine solche zulässig wäre und wo dies im Gesetz geregelt ist. Anschließend wandte er sich der Frage des zulässigen Rechtswegs zu und ließ uns erläutern, auf welcher Vorschrift die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichtsbarkeit beruht. Darauf aufbauend diskutierten wir, welche Konsequenzen sich ergeben, wenn ein Verfahren irrtümlich vor dem falschen Rechtsweg anhängig gemacht wird, worin der Unterschied zur Verweisung nach § 281 ZPO liegt, und ob eine solche Verweisung mit einem Rechtsmittel angreifbar ist. Besonders wichtig war dem Prüfer dabei, dass die Parteien vor einer Verweisung zu hören sind – hier zielte er auf Art. 103 Abs. 1 GG und das verfassungsrechtlich garantierte rechtliche Gehör ab. Im Anschluss kehrten wir zum konkreten Fall zurück. Der Prüfer wollte wissen, was bis zum Aufrechnungseinwand rechtlich geschehen war – mit unseren Antworten zeigte er sich allerdings unzufrieden. Er leitete uns deshalb auf § 138 ZPO und forderte eine systematische Darstellung dieses Paragrafen, insbesondere im Hinblick auf Darlegungs- und Wahrheitspflichten der Parteien. Da auch hier keine zufriedenstellende Darstellung erfolgte, lenkte er die Diskussion auf die Begriffe der Schlüssigkeit der Klage und die Erwiderungsobliegenheit des Beklagten. Die zentrale Frage war dann, was der Kläger zu beweisen habe. Dabei ging es zunächst um die Entstehung des Vertrags und der damit verbundenen Zahlungspflicht. Besonders lange verweilten wir jedoch bei der Frage, warum die Lieferung der Apfelsinen durch Zeugenaussage bewiesen werden musste. Hier beleuchteten wir zunächst die Beweislastverteilung und arbeiteten dann heraus, dass der Kläger durch die Beweisführung eine sogenannte „Zug-um-Zug-Verurteilung“ vermeiden wollte. Dies führte zu Nachfragen, wo eine solche geregelt ist, was ein Zurückbehaltungsrecht bedeutet und ob es im vorliegenden Fall einschlägig sei. Schließlich stellten wir klar, dass der Kläger substantiiert vorgetragen hatte, es habe ein gegenseitiger Vertrag bestanden, der eine Zahlungspflicht begründet habe. Der Beklagte hatte dies zwar bestritten, doch nach der Beweisaufnahme sah das Gericht den Vertragsschluss als erwiesen an – und damit auch die Entstehung der Gegenleistungspflicht. Diese würde allerdings nur dann entfallen, wenn bereits Erfüllung im Sinne des § 362 BGB eingetreten wäre. Da dies ein für den Kläger günstiger Umstand war, trug er hierfür die Beweislast. In diesem Zusammenhang wurde auch der Begriff des Schuldverhältnisses im Sinne des § 362 BGB sowie die Unterscheidung zum Schuldverhältnis im engeren Sinn thematisiert. Zum Ende der Sitzung kamen wir nochmals kurz zur Aufrechnung zurück. Es wurde die Frage aufgeworfen, weshalb die Reihenfolge, in der Forderungen zur Aufrechnung gestellt werden, von Bedeutung ist – dies mit Blick auf die materielle Rechtskraft nach § 322 Abs. 2 BGB. Auch die prozessualen Folgen einer Aufrechnung, insbesondere im Hinblick auf die Kostenentscheidung, wurden angesprochen – einschließlich der entsprechenden Norm. Der Prüfer ging sehr detailliert auf alle Themen ein, die im Verlauf angesprochen wurden, und stellte präzise Nachfragen. Er legte großen Wert auf die saubere Anwendung und Begründung mit Gesetzesnormen sowie die Verwendung juristisch präziser Begriffe. Dabei unterstützte er bei Unsicherheiten, erwartete aber eine eigenständige und strukturierte Herangehensweise an die rechtlichen Fragestellungen.
Bei den obigen anonymisierten Protokollen handelt es sich um eine Original-Mitschrift aus dem zweiten Staatsexamen der Mündlichen Prüfung in Hessen vom Mai 2025. Das Protokoll stammt aus dem Fundus des Protokollverleihs Juridicus.de.
Weggelassen wurden die Angaben zum Prüferverhalten. Die Schilderung des Falles und die Lösung beruhen ausschließlich auf der Wahrnehmung des Prüflings.