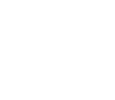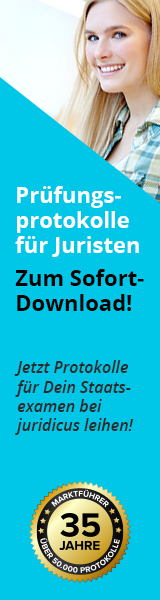Prüfungsthemen: Zivilrecht
Vorpunkte der Kandidaten
|
Kandidat |
1 |
|
Endpunkte |
7,91 |
|
Endnote |
7,91 |
|
Endnote 1. Examen |
7,01 |
Zur Sache:
Prüfungsthemen: aktuelle Fälle
Prüfungsthemen: Zwangsvollstreckung
Paragraphen: §802 ZPO
Prüfungsgespräch: Frage-Antwort, hält Reihenfolge ein, verfolgt Zwischenthemen
Prüfungsgespräch:
Der Prüfer nahm den zuvor gehaltenen Aktenvortrag als Anknüpfungspunkt für seine Fragen und stieg mit dem Themenkomplex der Vollstreckungsorgane ein. Zunächst ging es dabei um das Vollstreckungsgericht. Einer der Kandidaten erklärte, dass es sich hierbei um das Amtsgericht im Gerichtsbezirk handle, in dem die Vollstreckung durchzuführen sei. Hervorgehoben wurde zudem, dass es sich hierbei um einen ausschließlichen Gerichtsstand handelt. Im Anschluss daran wollte der Prüfer auf die Frage hinaus, wer innerhalb des Amtsgerichts für die Vollstreckung zuständig ist, und zielte damit auf die Rolle des Rechtspflegers ab. Daraufhin wandte sich der Prüfer der nächsten Kandidatin zu. Diese sollte weitere Vollstreckungsorgane nennen. Sie führte den Gerichtsvollzieher an und erläuterte, welche Aufgaben diesem zukommen. Dabei ging sie darauf ein, dass der Gerichtsvollzieher Pfändungen vornimmt, Vermögensauskünfte abnimmt und gegebenenfalls auch Zwangsmaßnahmen durchführt. Sie stellte außerdem dar, wie die praktische Durchführung einer Vollstreckung durch den Gerichtsvollzieher abläuft. Im nächsten Schritt kam der Prüfer auf das Prozessgericht erster Instanz zu sprechen. Dies wurde von einem weiteren Kandidaten als Vollstreckungsorgan benannt. In diesem Zusammenhang wurde diskutiert, welche Rolle dieses Gericht im Rahmen der Vollstreckung spielt. Besonders vertieft wurde die Frage, wie eine Willenserklärung vollstreckt werden kann. Hierbei stand der Gedanke der Fiktion im Mittelpunkt: Wird eine Willenserklärung nicht abgegeben, kann sie durch gerichtliche Entscheidung ersetzt werden und gilt damit rechtlich als abgegeben. Anschließend lenkte der Prüfer das Gespräch auf Unterlassungserklärungen. Thematisiert wurde, wie Ordnungsgeld oder Ordnungshaft in der Vollstreckung eingesetzt werden, um die Befolgung einer Unterlassungsverpflichtung sicherzustellen. Dabei wurde der Charakter dieser Mittel als Druckinstrument verdeutlicht, das darauf abzielt, den Schuldner zum Einhalten des gerichtlichen Tenors zu bewegen. Die vierte Kandidatin sollte sodann ein weiteres Vollstreckungsorgan nennen. Sie nannte das Grundbuchamt, und im Gespräch wurde deutlich, dass dieses im Zusammenhang mit der Zwangsversteigerung von Grundstücken tätig wird. Das Grundbuchamt spielt insofern eine Rolle, als es die notwendigen Eintragungen im Grundbuch vornimmt, um die Vollstreckung in das Grundstück durchzuführen. Nach diesem Teil leitete der Prüfer zu einem aktuellen Fall aus seiner eigenen gerichtlichen Tätigkeit über. Ein kleiner Verein hatte Klage erhoben, um Zugang zu Gebäuden eines Tochterunternehmens von VW zu erhalten. Zunächst stand die Überlegung im Raum, ob ein solcher Anspruch überhaupt bestehen könnte. Einer der Kandidaten äußerte, dass einem Verein grundsätzlich kein Zutritt gewährt werden müsse, da es hierfür keine ersichtlichen Gründe gebe, sofern keine ausdrückliche gesetzliche oder vertragliche Grundlage vorliegt. Der Prüfer erläuterte daraufhin, dass es sich um einen Verein handelte, der die Interessen von Arbeitnehmern wahrnehmen sollte. Dies führte zu einem Hinweis auf das Mitbestimmungsgesetz, das bereits Regelungen zur Arbeitnehmervertretung innerhalb von Gesellschaften wie einer GmbH vorsieht. Im weiteren Verlauf wurde die Frage gestellt, aus welchen Grundrechten sich ein solcher Anspruch ableiten ließe. Dabei kam insbesondere die Koalitionsfreiheit in Betracht. Daran anschließend wurde erörtert, inwieweit Grundrechte unmittelbare Wirkung zwischen Privaten entfalten können und ob ein Verein sich darauf berufen könnte. Dies führte zu einer Diskussion über den Begriff der praktischen Konkordanz, also das Gebot, kollidierende Grundrechte so in Einklang zu bringen, dass beide möglichst weitgehend zur Geltung kommen. Darauf aufbauend kam die Zusatzfrage, wie der Fall zu bewerten wäre, wenn es sich um einen Verein mit rechtsextremem Hintergrund handelte, also etwa um einen AfD-nahen Zusammenschluss. Damit verbunden war die Problematik, ob und in welchem Umfang auch solchen Gruppen ein Anspruch auf Zugang oder Mitwirkung zustehen kann und wie in diesem Zusammenhang Grundrechte gegeneinander abzuwägen sind. Zum Schluss stellte der Prüfer noch Fragen zum Beweisrecht. Diskutiert wurde, wie die Mitgliedschaft in einem Verein nachgewiesen werden kann. Die Kandidaten gingen darauf ein, dass eine bloße Behauptung regelmäßig nicht ausreicht. Erwähnt wurde die Möglichkeit, durch ein Sachverständigengutachten, etwa mittels Schriftvergleich, die Mitgliedschaft gerichtsfest zu belegen.
Bei den obigen anonymisierten Protokollen handelt es sich um eine Original-Mitschrift aus dem zweiten Staatsexamen der Mündlichen Prüfung in Niedersachsen vom August 2025 Das Protokoll stammt aus dem Fundus des Protokollverleihs Juridicus.de.
Weggelassen wurden die Angaben zum Prüferverhalten. Die Schilderung des Falles und die Lösung beruhen ausschließlich auf der Wahrnehmung des Prüflings.