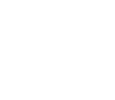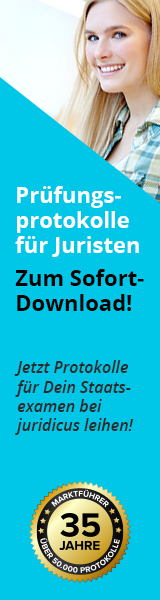Prüfungsthemen: Zivilrecht
Vorpunkte der Kandidaten
|
Kandidat |
1 |
|
Endpunkte |
6,5 |
|
Endnote |
7,25 |
|
Endnote 1. Examen |
8,32 |
Prüfungsgespräch:
Die Zivilrechtsprüfung begann mit einem prozessualen Einstieg anhand kleinen Falls, der in genau dieser Form auch in dem grünen Buch „Die mündliche Zivilrechtsprüfung im Assessorexamen“ (Thürling/Pragst) zu finden ist. Die Prüferin legte uns genau diesen Sachverhalt ausgedruckt vor, in dem der Kläger von seiner Mutter von der gesetzlichen Erbfolge ausgeschlossen wurde. Seine Schwester war Alleinerbin geworden, verweigerte jedoch die Auskunft über Bestand und Höhe des Nachlasses. Der Kläger beantragte daher in Form einer Stufenklage (das galt es zu erkennen) zunächst Auskunft über den Nachlass, sodann die Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung und schließlich die Zahlung seines Erbteils in Höhe von einem Viertel. Zunächst wollte die Prüferin hören, um welche Klageart es sich handelt. Erwartet wurde die zutreffende Einordnung als Stufenklage nach § 254 ZPO. Im Anschluss fragte sie nach, warum die Stufenklage überhaupt zugelassen ist. Hier war § 253 Abs. 2 ZPO maßgeblich: Grundsätzlich muss die Klage einen bestimmten Antrag enthalten; bei der Stufenklage wird dieses Erfordernis durch die Verbindung von unbestimmtem Leistungsantrag mit einem Hilfsantrag auf Auskunft durchbrochen, was die Vorschrift ausdrücklich gestattet. Im weiteren Verlauf wurden die Vor- und Nachteile der Stufenklage diskutiert. Vorteil: Der Kläger kann seine Ansprüche in einem einheitlichen Verfahren geltend machen, ohne zuvor Auskunftsklage und Zahlungsklage getrennt erheben zu müssen (Prozessökonomie). Weiterhin ist die Verjährungshemmung als Vorteil zu nennen. Nachteil: Es handelt sich um ein langwieriges Verfahren, da die einzelnen Stufen nacheinander durchlaufen werden müssen, sodass nicht unbedingt mit schnellerem „Erfolg“ gerechnet werden kann. Anschließend fragte die Prüferin nach Auskunftsansprüchen im Erbrecht sowie anderen bekannten Auskunftsansprüchen. Genannt werden konnten etwa § 1605 BGB (gegenseitige Auskunftspflichten zwischen Verwandten in gerader Linie), § 1379 BGB (Zugewinnausgleich), § 2027 BGB (Auskunftspflicht des Erbschaftsbesitzers) sowie die allgemeinen Auskunftsansprüche aus Treu und Glauben (§ 242 BGB) etc. Da ich und eine weitere Kandidatin unseren Aktenvortrag im Familienrecht hielt, wurden wir explizit nach Auskunftsansprüchen im Familienrecht gefragt (Unterhalt, Zugewinn). Sodann ging es in die materiell-rechtliche Lösung des Falles. Hier stand der Pflichtteilsanspruch nach § 2303 BGB im Vordergrund, der sich über den Weg der Stufenklage effektiv durchsetzen lässt. Im prozessualen Teil wollte die Prüferin wissen, welches Urteil nach Abschluss der ersten Stufe ergeht. Richtig war hier das Teilurteil nach § 301 ZPO. Hieran knüpfte die Frage an, wie die Kostenentscheidung im Rahmen des Teilurteils aussehen würde (Fangfrage!!): eine Kostenentscheidung ergeht im Teilurteil gerade nicht, da der Rechtsstreit insgesamt noch nicht abgeschlossen ist. Demgegenüber wird aber bereits die vorläufige Vollstreckbarkeit tenoriert, sodass insoweit bereits eine Entscheidung im Urteil enthalten ist. Dies wollte sie explizit herausgearbeitet wissen. Im Anschluss brachte die Prüferin eine Abwandlung: Es stellte sich heraus, dass das gesamte Vermögen bereits verbraucht war und die Klage von Anfang an aussichtslos gewesen ist. Nun ging es um die Frage, wie die Kostenentscheidung in diesem Fall aussieht. Wir sollten erkennen, dass der Kläger grds. nach § 91 ZPO die Kosten trägt. Angesprochen wurde außerdem die Frage der Billigkeit: Sie wollte wissen, ob wir es der Billigkeit entsprechend finden, dass der Kläger die gesamten Kosten zu tragen hätte, obgleich seine Schwester ihm vorgerichtlich Anlass zur Klageerhebung gegeben hat. Abschließend fragte die Prüferin, was der Kläger nun am besten tun solle (Erledigungserklärung/ Klagerücknahme etc. unter Nennung der Normen, prozessualen Behandlung und der konkreten Folgen) Die Prüferin erwies sich während der gesamten Prüfung als sehr freundlich und unterstützend. Sie legte Wert auf eine klare Nennung der Normen und die Fähigkeit, die Grundstruktur des Zivilprozesses darzustellen. Detailwissen war nicht erforderlich; entscheidend war, dass die Basics sicher beherrscht werden und das Zusammenspiel von materiell-rechtlichem Anspruch und prozessualem Vorgehen nachvollziehbar darstellten. Insgesamt hinterließ die Prüfung einen wohlwollenden Eindruck, auch im Hinblick auf die Benotung.
Bei den obigen anonymisierten Protokollen handelt es sich um eine Original-Mitschrift aus dem zweiten Staatsexamen der Mündlichen Prüfung in Hessen vom September 2025 Das Protokoll stammt aus dem Fundus des Protokollverleihs Juridicus.de.
Weggelassen wurden die Angaben zum Prüferverhalten. Die Schilderung des Falles und die Lösung beruhen ausschließlich auf der Wahrnehmung des Prüflings.