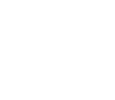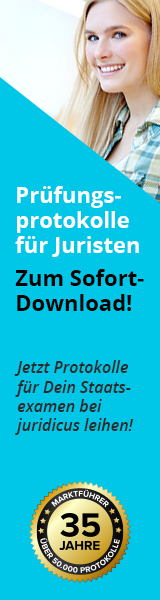Prüfungsthemen: Zivilrecht
Vorpunkte der Kandidaten
|
Kandidat |
1 |
|
Endpunkte |
4,3 |
|
Endnote |
5,8 |
|
Endnote 1. Examen |
6,1 |
Zur Sache:
Prüfungsthemen: protokollfest, aktuelle Fälle
Prüfungsthemen: Werkvertragsrecht, Waschanlagenfall, AGB-Kontrolle, Erfüllungsgehilfe, Vertragsschluss, Annahme, Angebot, Analogie-Kriterien
Paragraphen: §631 BGB, §280 BGB, §241 BGB, §307 BGB, § 278 BGB
Prüfungsgespräch: Frage-Antwort-Diskussion, hält Reihenfolge ein, verfolgt Zwischenthemen, Fragestellung klar
Prüfungsgespräch:
Prüfung aktueller Rechtsprechung oder rechtspolitischer Themen: Urt. v. 21.11.2024, Az. VII ZR 39/24 Waschanlage, Werkvertragsrecht, Verkehrssicherungspflicht, AGB-Prüfung, Haftungsausschluss beim Verbrauchervertrag https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/bgh-viizr15724-tankdeckel-waschanlage-schadensersatz-serienausstattung Urt. v. 22.05.2025, Az. VII ZR 157/24 kurz vorab: Es kamen nicht 1:1 die unter „Aktuelles“ genannten BGH-Entscheidungen dran. Jedoch gab es Parallelen zu unserem Fall. Da wir alle diese neuen Entscheidungen aus dem Werkvertragsrecht gelesen hatten (LTO), konnten wir gut argumentieren. Der Prüfer fragte jedoch nicht aktiv nach der aktuellen Rechtsprechung und man konnte den Fall auch ohne Kenntnis der Rechtsprechung lösen. Er begann damit uns einen kurzen Fall langsam zu diktieren, sodass man gut mitschreiben konnte: G betreibt eine automatische Autowaschanlage. Vor der Einfahrt in die Waschstraße hängt neben dem Ticketautomaten ein großes deutlich lesbares Schild: „Haftungsausschluss: Beschädigungen an der Karosserie außen z.B. Zierleisten, Antennen etc. sind von der Haftung, mit Ausnahme eines groben Verschuldens des Waschanlagenunternehmers, ausgeschlossen.“ K fährt mit seinem privat genutzten VW-Bus in die Waschstraße und stellt ihn ordnungsgemäß ab. Durch den Waschvorgang ist die Halterung der Markise auf der Beifahrerseite abgebrochen. Dies lag daran, dass die Waschwalzen einen zu geringen Abstand zur Karosserie hatten. Am Vorabend hatte der Mitarbeiter M den Abstandssensor nicht richtig gereinigt, obwohl G ihn dazu beauftragt hatte. K musste das Auto für 900 € reparieren lassen. Hat K gegen G einen Anspruch auf Schadensersatz i.H.v. 900 €? Der Prüfer prüfte die Kandidaten von links nach rechts (aus Kandidatenperspektive), grundsätzlich nach der Reihenfolge, ab. Da ich als Erste dran war, zählte ich zunächst die möglichen AGL auf, ordnete den Vertrag als Werkvertrag ein und grenzte die Haupt- und Nebenleistungspflicht ab. Abgrenzung Werk- vom Dienstvertrag: Der Dienstvertrag richtet sich auf eine Tätigkeit, der Werkvertrag auf die Herbeiführung eines Erfolges. Ich nahm zunächst die grobe Einordnung vor, dass grds. ein SEA aus §§ 634 Nr. 4, 280 I oder aus §§ 280 I, 241 II, 631 BGB in Betracht kommen kann. Hier liegt jedoch kein Sachmangel gem. § 634 Nr. 1 635 BGB vor, weil das Auto nach der Wäsche sauber war. Der Prüfer fragte dann: „Warum sollte man mit den Gewährleistungsrechten beginnen?“ Weil sie vorrangig sind, soweit der Anwendungsbereich eröffnet ist. Die richtige AGL war: §§ 280 I, 241 II, 631 BGB. Dann gingen wir die einzelnen Prüfungspunkte von § 280 I durch. Er fragte: „worin könnte das Schuldverhältnis liegen?“ Dieses besteht aufgrund des Werkvertrages. Dann kleinschrittiger: „Was braucht man für einen Werkvertrag?“ Zwei übereinstimmende Willenserklärungen: Angebot und Annahme (§§ 145 ff. BGB). Worin könnte hier das Angebot liegen? Die Kandidatin sagte: Das Angebot des G erfolgte durch das Aufstellen der Ticketautomaten und die Annahme von K durch das Geld einwerfen. Da hackte der Prüfer nochmal nach: „Hat G durch das Aufstellen des Ticketautomaten schon ein Angebot an K abgegeben?“ Die Kandidatin:“ Nein, das war nur eine offerta ad incertas personas.“ Richtig ist: Der Kunde gibt durch das Befahren/Bezahlen der Waschstraße ein Angebot zur Reinigung seines Fahrzeugs ab, und die Annahme dieses Angebots erfolgt konkludent durch den Betreiber, indem er das Fahrzeug durch die Anlage führt. Pflichtverletzung: Nebenpflichtverletzung (§ 241 II BGB), da das Eigentum (VW-Bus) beschädigt worden ist. Er fragte: „inwieweit besteht die Nebenpflicht?“ Hat der Unternehmer (G) hier das Auto aktiv zerstört? Nein, hier liegt ein Unterlassen vor. In Betracht kommt eine Verkehrssicherungspflicht. Der Kandidat definierte von sich aus:“ Wer eine Gefahrenquelle schafft oder unterhält, hat die Pflicht, die notwendigen und zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um eine Schädigung anderer zu verhindern.“ Und welche Gefahrenquelle wurde hier eröffnet? Der G betreibt eine vollautomatisierte Waschanlage mit erheblicher mechanischer Gewalt. Somit besteht eine erhebliche Gefahr für die Kunden, dass das Eigentum durch eine Fehlfunktion beschädigt werden kann. Somit musste G hier im Rahmen seiner Betriebsorganisationspflicht Sorge dafür tragen, dass die betrieblichen Abläufe so gestaltet sind, dass Gefahrenquellen erkannt und beseitigt oder zumindest minimiert werden. Der Betreiber muss somit die Organisation gewährleisten und ggfs. stichprobenartig Kontrollen durchführen. „Welche Pflicht hat G hier somit konkret verletzt?“ Er selbst keine, jedoch sein Mitarbeiter M. Er hat die Sensoren nicht ordnungsgemäß gereinigt. Der Kandidat sagte:“ man könnte dem G jedoch die Pflichtverletzung zurechnen.“ Herr Petermann: „Wie ginge das z.B.? Was könnte er denn sein?“ Der Kandidat: „Erfüllungsgehilfe, sodass man nach § 278 BGB zurechnen könnte.“ Herr Petermann: „Ja, aber eigentlich zieht man § 278 BGB ja noch nicht bei der Pflichtverletzung, sondern erst beim Vertreten müssen heran. Was könnte man hier also machen?“ Der Kandidat: „Analoge Anwendung von § 278 BGB?“ Herr Petermann: “Das setzt voraus?“ Der Kandidat: „Eine planwidrige Regelungslücke bei vergleichbarer Interessenlage.“ Die einzelnen Voraussetzungen wurden dann näher erörtert und zügig subsumiert, wobei Herr Petermann auch eifrig nickte. Somit konnte die Pflichtverletzung bejaht werden. Zum Vertreten müssen fragte Herr Petermann:“ Was gilt denn generell beim Vertreten müssen, da gibt es doch so eine Norm?“ Daraufhin: “§ 276 BGB, Vorsatz und Fahrlässigkeit.“ „Ja, und was noch?“ „Die Vermutungsregel gemäß § 280 I 2 BGB.“ Genau! Danach wurde wieder auf § 278 BGB abgestellt und der Erfüllungsgehilfe definiert und vom Verrichtungsgehilfen abgegrenzt. Mir ist dabei aufgefallen, dass Herr Petermann nicht auf den genauen Wortlaut der Definition achtet. Aber die Schlagwörter/Voraussetzungen in der Definition sollten stimmen. „Wie ist es in unserem Fall mit Vorsatz und Fahrlässigkeit, da gab es doch eine Besonderheit.“ Der Haftungsausschluss. Dann wurde kleinschrittig eine AGB-Prüfung vorgenommen. Handelt es sich um eine AGB? (+) Wortlaut von § 305 I 1 BGB. Welche Besonderheit gibt es hier? Es handelt sich um einen Verbrauchervertrag, sodass § 310 III BGB berücksichtigt werden muss. Er fragte sodann: “Kennen Sie vielleicht auch noch die Normen für den Verbraucher und Unternehmer?“ „Ja, §§ 13, 14 BGB.“ Die Klausel wurde durch den gut erkennbaren Aushang auch wirksam gemäß § 305 II BGB einbezogen. §§ 305 b, c BGB kamen nicht in Betracht. Die Kandidatin wollte dann sofort auf die Inhaltskontrolle springen. Herrn Petermann war es wichtig noch die Gesetzesabweichung gem. § 307 III BGB festzustellen. Daher lenkte er die Kandidatin mithilfe seiner Fragen dort hin. Nach der Subsumtion fand die Inhaltskontrolle nach §§ 307-309 BGB statt. Es wurde der Wortlaut der Klausel ausgelegt. Wer ist der Waschanlagenbetreiber? Derjenige, der wirtschaftlich dahintersteht. Es muss eine verbrauchergünstige Auslegung stattfinden. Hier liegt die Besonderheit vor, dass der Kunde das Auto in die Risikosphäre des Betreibers abgibt. Der Ausschluss des groben Verschuldens ist verbraucherungünstig. Grobes Verschulden war für die Beschädigungen ausgeschlossen. Somit liegt ein Verstoß gegen § 309 Nr. 7 b) BGB vor. Ein Verstoß gegen § 307 Nr. 1 BGB bestand nicht, jedoch war § 307 Nr. 2 BGB einschlägig, davon sind auch Nebenleistungspflichten erfasst. Die Klausel verstößt gegen §§ 309 Nr. 7 b) und § 307 II BGB und nur diese Klausel ist daher gemäß § 306 II BGB unwirksam und wird durch die gesetzliche Regel (=§ 276 BGB) ersetzt. Hier handelte M zumindest fahrlässig gemäß § 276 BGB, sodass G die Pflichtverletzung auch zu vertreten hatte. Hier liegt nach der Differenzhypothese auch ein Schaden in Höhe von 900€ vor. Dieser ist gemäß § 249 II 1 BGB ersatzfähig. Die Kandidatin nannte zunächst § 249 I BGB, woraufhin Herr Petermann etwas lachend hinzufügte: also will K hier, dass G höchstpersönlich das Auto repariert (Naturalrestitution)? Die Kandidatin lehnte lächelnd ab und kam somit zu § 249 II 1 BGB. Anschließend stellten wir noch kurz fest, dass auch ein Anspruch aus § 823 I, § 831 BGB besteht. Bald hast du es auch geschafft und bist Volljurist*in! Halte jetzt noch die letzten Wochen durch und höre auf dich! Lass dich von anderen, den langen Protokollen oder von schlecht laufenden Aktenvorträgen kurz vor dem Termin, nicht stressen. Im Ernstfall kannst du nochmal viel mehr abrufen.
Bei den obigen anonymisierten Protokollen handelt es sich um eine Original-Mitschrift aus dem zweiten Staatsexamen der Mündlichen Prüfung in NRW vom Juni 2025 Das Protokoll stammt aus dem Fundus des Protokollverleihs Juridicus.de.
Weggelassen wurden die Angaben zum Prüferverhalten. Die Schilderung des Falles und die Lösung beruhen ausschließlich auf der Wahrnehmung des Prüflings.