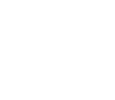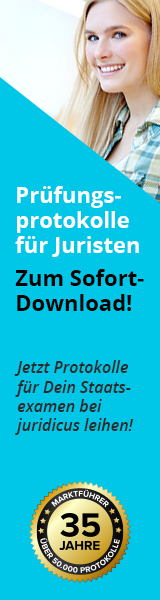Prüfungsthemen: Öffentliches Recht
Vorpunkte der Kandidaten
|
Kandidat |
1 |
|
Endpunkte |
18,0 |
|
Endnote |
18,0 |
|
Endnote 1. Examen |
18,0 |
Zur Sache:
Prüfungsstoff: aktuelle Fälle
Prüfungsthemen: Arbeit mit einer unbekannten Norm, Europarecht, Berufsfreiheit, einstweiliger Rechtsschutz
Paragraphen: §123 VwGO, §267 AEUV, §100 GG
Prüfungsgespräch: Frage-Antwort-Diskussion, hält Reinefolge ein, lässt Meldungen zu, Intensivbefragung Einzelner, hart am Fall
Prüfungsgespräch:
Zu Beginn der Prüfung händigte der Prüfer die §§ 1, 2 und 7 des Transfusionsgesetzes (TFG) sowie die §§ 2 und 3 des Arzneimittelgesetzes (AMG) aus und stellte daraufhin folgenden Fall vor: Sachverhalt: Ein Heilpraktiker, Mandant M, sucht rechtlichen Rat. Er möchte seinen Patienten Eigenblut entnehmen, um dieses anschließend an entzündeten Körperstellen wieder zu injizieren. Dadurch sollen Entzündungen gelindert, die Durchblutung verbessert und die Selbstheilungskräfte des Körpers angeregt werden. Zwei Varianten stehen zur Debatte: 1.: Das Blut wird unmittelbar nach der Entnahme wieder eingespritzt. 2.: Das Blut wird nach der Entnahme mit einer Ozon-Sauerstoff-Mischung angereichert und anschließend injiziert. Die Bezirksregierung hat jedoch entschieden, dass Heilpraktiker keine Eigenblutbehandlungen durchführen dürfen, da diese unter das Transfusionsgesetz fallen. M möchte Rechtssicherheit erlangen und schreibt an das Gericht: „Hohes Gericht, die Bezirksregierung verbietet mir auf Grundlage des § 7 Abs. 2 TFG die Eigenbluttherapie. Ich sehe mich dadurch in meiner Berufsfreiheit beeinträchtigt und bitte um eine schnelle Klärung – notfalls auch im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes.“ Einstieg in die Prüfung: Der Prüfer eröffnete die Prüfung mit der Frage, ob die Entnahme von Blut grundsätzlich erlaubt sei. Die richtige Herangehensweise lautete: Jedes Handeln ist erlaubt, solange kein Gesetz es verbietet. Da das Transfusionsgesetz eine Verbotsnorm darstellt, war dessen Anwendungsbereich näher zu prüfen. Zentral ging es darum, ob die geplante Eigenbluttherapie unter das in § 7 Abs. 2 TFG geregelte Verbot fällt. Der Prüfer legte großen Wert auf eine saubere juristische Struktur, eine präzise Subsumtion und Normverständnis. Zunächst wurde diskutiert, was unter einer „ärztlichen Person“ zu verstehen ist. Nach dem allgemeinen Sprachgebrauch sind damit Personen gemeint, die ein abgeschlossenes Medizinstudium nachweisen und somit ärztlich qualifiziert sind. Der Zweck der Regelung spricht ebenfalls für eine enge Auslegung: Sie soll Patientinnen und Patienten vor gesundheitlichen Risiken durch medizinisch nicht ausgebildetes Personal schützen. Dann kam die Frage auf, ob es sich bei der Eigenblutbehandlung um eine Spende im Sinne des § 2 TFG handelt. Gemeinsam entwickelten wir, dass nach dem Wortsinn Spende bedeutet, dass etwas einer anderen Person zugewendet wird – was hier nicht der Fall ist. Allerdings dient die Vorschrift dem Zweck, die sichere Gewinnung und den hygienischen Umgang mit Blut zu gewährleisten, unabhängig davon, wem es letztlich zugutekommt. Deshalb kann auch die Eigenblutentnahme als Spende gelten. Der Prüfer wendete sich nun der Frage zu, ob Eigenblut ein Wirkstoff oder Arzneimittel im Sinne der §§ 2, 3 AMG ist. Unter Rückgriff auf die Begriffsbestimmungen dieser Vorschriften wurde dies bejaht. Die vom Mandanten geplante Eigenblutbehandlung fällt somit grundsätzlich unter das Verbot des § 7 Abs. 2 TFG. Im weiteren Verlauf stellte der Prüfer die Zusatzfrage, wie zu verfahren wäre, wenn der Mandant geltend macht, das Verbot verletze seine Menschenrechte. Er fragte, wie Verwaltungsgericht darauf reagieren könnte. Ein Kandidat antwortete, dass das Verwaltungsgericht gemäß Art. 100 Abs. 1 GG ein Normenkontrollverfahren anregen oder – bei einem möglichen Konflikt mit Unionsrecht – eine Vorlage an den EuGH nach Art. 267 AEUV veranlassen könnte. Dabei seine die Voraussetzungen an die abstrakte Normenkontrolle höher, da das vorlegende Gericht von der Verfassungswidrigkeit überzeugt sein muss. Bei der Vorlage an den EuGH genügt dagegen bereits der Zweifel, ob eine Norm mit Unionsrecht vereinbar ist. Zum Schluss wurde untersucht, ob das Verbot der Eigenblutbehandlung gegen die Berufsfreiheit aus Art. 12 Abs. 1 GG verstößt. Auf der Eingriffsebene erfolgte die Einordnung nach der Drei-Stufen-Theorie. Der Prüfer stellte fest, dass es sich um eine Regelung der Berufsausübung (erste Stufe) handelt. Diese kann durch vernünftige Erwägungen des Gemeinwohls gerechtfertigt werden. Der Schutz der Gesundheit erfüllt dieses Kriterium, sodass keine Verletzung der Berufsfreiheit vorliegt. Abschlussfragen: Zum Ende der Prüfung erkundigte sich der Prüfer nach der richtigen Klageart. Es handelt sich um eine Feststellungsklage. Im einstweiligen Rechtsschutz wäre ein Antrag nach § 123 Abs. 1 VwGO statthaft. Damit wurde die Prüfung beendet.
Bei den obigen anonymisierten Protokollen handelt es sich um eine Original-Mitschrift aus dem zweiten Staatsexamen der Mündlichen Prüfung in NRW vom September 2025. Das Protokoll stammt aus dem Fundus des Protokollverleihs Juridicus.de.
Weggelassen wurden die Angaben zum Prüferverhalten. Die Schilderung des Falles und die Lösung beruhen ausschließlich auf der Wahrnehmung des Prüflings.