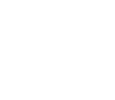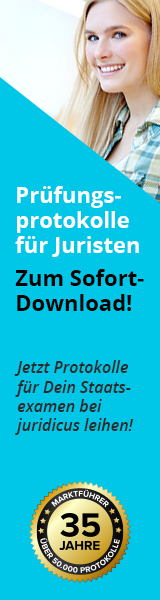Prüfungsthemen: Öffentliches Recht
Vorpunkte der Kandidaten
|
Kandidat |
1 |
|
Endpunkte |
11,35 |
|
Endnote |
12,28 |
|
Endnote 1. Examen |
11,66 |
Zur Sache:
Prüfungsstoff: aktuelle Fälle
Prüfungsthemen: Straßenverkehrsrecht, Religionsfreiheit, Verwaltungsrecht-AT, Verwaltungsprozessrecht
Paragraphen: §46 StVO, §23 StVO, §113 VwGO, §114 VwGO, §40 VwGO
Prüfungsgespräch: Frage-Antwort-Diskussion, lässt Meldungen zu, Intensivbefragung Einzelner, verfolgt Zwischenthemen, Fragestellung klar
Prüfungsgespräch:
Die Prüferin teilte uns einen Sachverhalt aus, den sie uns laut vorlas. Es ging dabei um eine Frau, die aus religiösen Gründen ein Niqab, d.h. eine Gesichtsverschleierung (dies war im Sachverhalt beschrieben), trug. Diese wollte sie auch beim Autofahren tragen. Zu diesem Zweck beantragte sie beim Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz eine Ausnahmegenehmigung. Die entsprechende Verbotsnorm (§ 23 IV StVO) war im Sachverhalt abgedruckt. Abgedruckt war auch § 21a II StVO. Wir sollten dann zunächst das zuständige Gericht ermitteln. Über den Umweg dieser Frage sollte allerdings zunächst § 40 VwGO, d.h. die Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs, geprüft werden. Im Rahmen dieser Prüfung kamen wir dann auch auf die streitentscheidende Norm, d.h. die Anspruchsgrundlage für die Ausnahmegenehmigung zu sprechen. Es ging dann um die Abgrenzung von § 46 Abs. 1 und § 46 Abs. 2 StVO. Die richtige Anspruchsgrundlage war hier § 46 Abs. 2 StVO. Dann sollte die statthafte Klageart genannt werden, was hier die Verpflichtungsklage in Form der Versagungsgegenklage nach § 42 I Alt. 2 VwGO war. Wir kamen dann noch einmal auf das (sachlich) zuständige Gericht zu sprechen. Es sollte ausgehend von § 45 VwGO der Instanzenzug beschrieben werden (VG, OVG, BVerwG). Zudem sollten die verschiedenen Rechtsmittel genannt werden: In der Regel Antrag auf Zulassung der Berufung, wenn sie vom VG nicht zugelassen wurde, und Revision bzw. Nichtzulassungsbeschwerde. Die Prüferin fragte, ob man sich auch gegen Urteile des BVerwG noch zur Wehr setzten könne. Dabei wollte sie auf die Möglichkeit einer Verfassungsbeschwerde gegen Urteile hinaus. Sie fragte dabei auch nach dem Prüfungsmaßstab des BVerfG (das BVerfG prüft nur die Verletzung spezifischen Verfassungsrechts und ist gerade keine Superrevisionsinstanz). Es ging dann auch um die Besetzung der jeweiligen Spruchkörper am VG, OVG und BVerwG und die Übertragung auf den Einzelrichter, jeweils anhand der entsprechenden Normen in der VwGO. Die Prüferin wollte auch wissen, wann das OVG beispielsweise erstinstanzlich zuständig ist und wollte auf die abstrakte Normenkontrolle nach § 47 VwGO hinaus. Insofern wollte sie auch die entsprechende Norm im rheinlandpfälzischen AGVwGO hören, die die Prüfungsmöglichkeit nach § 47 I Nr. 2 VwGO eröffnet. Sodann sollte die Begründetheit der Klage untersucht werden. Es ging zunächst darum, dass § 46 II StVO letztlich keine Tatbestandsvoraussetzungen enthält, sodass nur das Ermessen zu prüfen war. Es wurde gefragt, wie das Ermessen vom Gericht überprüft werden könne, wobei die Norm des § 114 VwGO genannt und die verschiedenen Ermessensfehler aufgezeigt werden sollten. Dabei ging es dann auch um den Unterschied zwischen § 113 V 1 und § 113 V 2 VwGO. Wir kamen zu dem Ergebnis, dass ein Anspruch nur bestehen könne, wenn eine Ermessensreduzierung auf Null vorliegen würden. Es sollten Beispiele genannt werden, wann eine solche angenommen wird. Sodann prüften wir am Fall, ob sich eine Reduzierung des Ermessens zu einer Ausnahmegenehmigung aufgrund der Glaubensfreiheit der Klägerin ergeben könnte. Dies wurde umfassend besprochen und eine detaillierte Verhältnismäßigkeitsprüfung vorgenommen (Abwägung Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs, Leib und Leben der anderen Verkehrsteilnehmer gegen die Glaubensfreiheit der Klägerin). Wir gingen auch darauf ein, dass die Klägerin auf den ÖPNV ausweichen oder ein Motorrad benutzen könnte (§ 23 IV 2 i.V.m. § 21a II 1 StVO). Wir kamen zu dem Ergebnis, dass hier keine Reduzierung des Ermessens angenommen werden kann. Die Prüferin fragte dann noch, was man als Anwalt raten sollte, wenn man zwar von einem Ermessensfehler, nicht aber von einer Reduzierung auf Null ausgehen würde: Um eine negative Kostenentscheidung zu vermeiden, sollte man keinen Antrag nach § 113 V 1 VwGO, sondern nur einen solchen nach § 113 V 2 VwGO stellen. Die jeweiligen Anträge sollten dann noch ausformuliert werden.
Bei den obigen anonymisierten Protokollen handelt es sich um eine Original-Mitschrift aus dem zweiten Staatsexamen der Mündlichen Prüfung in Rheinland-Pfalz vom Mai 2025. Das Protokoll stammt aus dem Fundus des Protokollverleihs Juridicus.de.
Weggelassen wurden die Angaben zum Prüferverhalten. Die Schilderung des Falles und die Lösung beruhen ausschließlich auf der Wahrnehmung des Prüflings.